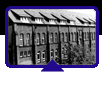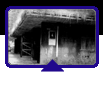![]() Einführung
Einführung
![]() Das
Werk
Das
Werk
![]() Spuren
der
Spuren
der
![]() Vergangenheit
Vergangenheit
![]() Biografische
Skizzen
Biografische
Skizzen
![]() Zeittafel
1935 - 1945
Zeittafel
1935 - 1945
![]() Zeittafel
nach 1945
Zeittafel
nach 1945
![]() Forschungsprojekt
Forschungsprojekt
![]() Dokumentationsstelle
Dokumentationsstelle
![]() Jugend AG
Jugend AG
![]()
Das
„Arbeitserziehungslager“
Das im Sommer 1940 eingerichtete sog. „Polizei-Gewahrsamslager“ der Gestapo
Hannover an der Schlossstraße in Liebenau wurde später in „Arbeitserziehungslager“
(AEL) Liebenau umbenannt. Es handelte sich um ein Holzbarackenlager mit
Stacheldrahtumzäunung, das nachts von Scheinwerfern hell erleuchtet wurde.
Das Lager bestand bis zum Mai 1943 - als die Gestapo es auflöste und die
verbliebenen Häftlinge in das neue AEL Lahde (bei Minden) zum Bau eines
Kraftwerkes verlegte. Heute befindet sich auf dem damaligen Gelände des
AEL Liebenau der Standort der St. Laurentiusschule und der Turnhalle.

An dieser Stelle befand sich das „Arbeitserziehungslager“ Liebenau. Eine
Gedenktafel am Schulgebäude erinnert an das Lager und die Todesopfer
Die Staatsanwaltschaft
Verden stellte zu Beginn der 60er Jahre im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens
fest: „Das Lager in Liebenau (...) wurde deshalb eingerichtet, damit der
Rüstungsfirma Eibia - Wolff & Co. - (billige) Arbeitskräfte zur Verfügung
gestellt werden konnten.“ Im Vorfeld der Einrichtung des Lagers hatte
die Firma Wolff & Co. ein Hilfegesuch an die Gestapo wegen massiver Probleme
bei der Errichtung der Pulverfabrik Liebenau gerichtet. In der Fabrik
mussten zu diesem Zeitpunkt 800 Polen und 500 Slowaken unter völlig unzureichenden
Bedingungen arbeiten. So fehlte es in der fortgeschrittenen Jahreszeit
vor allem an der notwendigen Kleidung. Die vernachlässigten Arbeitskräfte
hatten mit Protesten, Petitionen und Arbeitsverweigerungen reagiert, worauf
es zu ersten KZ-Einweisungen oder Polizeihaft kam. Vor allem gegenüber
den polnischen Arbeitern forderte die „Montan“ - als Gesellschaft des
Heereswaffenamtes, in deren Auftrag Wolff & Co. baute - harte Maßnahmen
und ihre Inhaftierung unter Polizeibewachung durch Umzäunung ihres damaligen
Wohnlagers. Der genaue Zeitpunkt der Einrichtung des Lagers sowie der
zeitliche Übergang vom sog. „Polizei-Gewahrsamslager“ zum späteren „Arbeitserziehungslager“
sind zur Zeit noch nicht exakt bestimmbar. Die durchschnittliche Zahl
der Lagerhäftlinge wird in verschiedenen Quellen mit 350 bis 500 Personen
angegeben. Das stacheldrahtbewehrte „Arbeitserziehungslager“ wurde im
Jahr 1941 durch zusätzliche Baracken erweitert. Nach Aussage des Baustellenleiters
von Wolff & Co. war es im Jahr 1943 mit 700 Häftlingen vollkommen überbelegt.
Neben der Ausbeutung der Arbeitskraft diente das Lager v.a. auch zur „Abschreckung“,
Einschüchterung und Disziplinierung der Arbeitskräfte auf der Baustelle
„Pulverfabrik“ selbst. Die heute nur in Ansätzen nachvollziehbare Häftlingsstruktur
des Lagers Liebenau wich gleichwohl von den per Erlass fixierten Richtlinien
ab. Dort hatte es geheißen: „Die Arbeitserziehungslager sind ausschließlich
zur Aufnahme von Arbeitsverweigerern und arbeitsunwilligen Elementen,
deren Verhalten einer Arbeitssabotage gleichkommt, bestimmt.“ So kam es
aber auch zu Inhaftierungen wegen sog. „Rassenschande“, des „Hörens von
Feindsendern“ oder von politischen Gegnern der Nationalsozialisten aus
den Gestapo-Bezirken Hannover und Hildesheim. Außerdem wurde das Lager
als Ausweich-Haftstätte für das überfüllte Amtsgerichtsgefängnis Nienburg
genutzt. Es entwickelte sich mit zunehmender Dauer vor allem zum Repressionsmittel
gegenüber den polnischen und sowjetischen Zwangsarbeitern. In enger Zusammenarbeit
zwischen Wolff & Co. und der Gestapo - vertreten durch den Betriebsingenieur
der Firma und Nienburgs Gestapoleiter R. - war eine Liste der Delikte
erstellt worden, die mit der Haft im AEL geahndet werden sollten: absichtliches
langsames oder fehlerhaftes Arbeiten, Unpünktlichkeit, Fernbleiben, Vortäuschen
einer Erkrankung oder Selbstverletzung, Ungehorsam gegen betriebliche
Vorgesetzte, „Miesmacherei“, Aufforderung zum Streik o.ä.. Zu den Haftgründen
äußerte sich Lagerkommandant Winkler im Jahr 1962: „Die Fremdarbeiter
hatten zum Beispiel auf den ‚freien Arbeitsstellen‘ nicht ausreichend
gearbeitet und wurden dann für 21 Tage oder 42 Tage eingewiesen. Als Deutscher
konnte man schon als ‚Querulant‘ eingewiesen werden, wenn es zur KZ-Einweisung
noch nicht reichte.“ Zu den Lebensbedingungen im Lager stellte die Staatsanwaltschaft
Verden im Jahr 1962 fest:
„Die allgemeinen Lagerverhältnisse entsprachen im wesentlichen denen eines
Konzentrationslagers. Die Häftlinge mußten bei schlechter Verpflegung
schwer arbeiten und wurden häufig mißhandelt. Die ärztliche Versorgung
war mangelhaft. Infolge dieser Verhältnisse starb eine große Zahl von
Häftlingen.“
Im Lager wurden die Häftlinge von Polizeireservisten der Schutzpolizei
Hannover bewacht, auf dem Arbeitsweg und auf der Baustelle übernahm dies
der Werkschutz der Firma Eibia. Ein ehemaliger Eibia-Wachmann berichtete
nach 1945: „Wir hatten die Anweisung, auf die Häftlinge zu schießen, wenn
sie von den Baustellen flüchten wollten.“ Von den Häftlingen des AEL,
die ausschließlich bei der Errichtung der Werksbauten eingesetzt wurden
(schwere Rodungs- und Erdarbeiten, Fundamenterstellung etc.), sind nach
Aktenlage die folgenden russischen Arbeiter auf der Baustelle der Firma
Wolff & Co. erschossen worden: Michael Babag am 22.06.1942 durch Kopfschuss,
Gregori Zadarozny am 04.09.1942 durch Bauchschuss und Wasil Lewtschenko
am 03.12.1942 durch Kopfschuss. Im gleichen Jahr wurden drei weitere russische
und ein polnischer Arbeiter durch Kopf-, Herz- und Lungenschüsse getötet.
Obgleich die Staatsanwaltschaft diese Vorgänge als „Erschießungen auf
der Flucht“ vermutete, lassen die Art der Verletzungen und zahlreiche
anderslautende Zeugenaussagen erhebliche Zweifel an dieser Einschätzung
zu. Die Zeugen sprechen von gezielten Morden und Hinrichtungen. Zur mangelhaften
Verpflegung und den Folgen werden hier die Aussagen ehemaliger Lagerhäftlinge
aus dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft herangezogen:
a) „Danach fand das Abendessen statt. Hierzu gab es zumeist zwei
oder drei ungeschälte Kartoffeln und dazu einen Löffel Rüben, d.h. eine
Suppe aus Rüben, Spinat, jungem Kohl, etwa 1/4 L. Zumeist war diese Suppe
nicht gut zubereitet. Die Kartoffeln waren überwiegend verfault oder gefroren.“
b) „Die Lagerhäftlinge waren sehr ausgehungert, wenn sie zur Arbeit
gingen, rissen sie das Gras aus und aßen es, auch Blätter von den Bäumen.
c) „Die Arbeit war furchtbar schwer, wenn man unsere Verpflegung
bedenkt, unsere Kleidung und die Stunden, die wir bei Wind und Wetter
verbringen mußten - das alles überstieg unsere Kräfte.“
d) „Die Häftlinge starben während der Arbeitszeit vor Erschöpfung.
Nach der Arbeit trug man die Leichen zum Lager. Solche Fälle ereigneten
sich mehr als zehn Mal wöchentlich.“
Der Staatsanwalt Verden kam zum Schluss „...daß die Häftlinge trotz der
ihnen zustehenden Schwerstarbeiterrationen im Lager außerordentlich schlecht
verpflegt wurden und deshalb nach längerem Lageraufenthalt erheblich entkräftet
waren.“ Während des Kriegsverlaufes hatte das Standesamt Liebenau insgesamt
277 Todesfälle unter Zwangsarbeitern beurkundet, davon starben 250 allein
im „Arbeitserziehungslager“. Der Staatsanwalt in Verden benannte im Juli
1962 folgende Nationalitäten der Toten: 164 Russen, 69 Polen, 6 Deutsche,
3 Dänen, 2 Franzosen, 1 Holländer, 1 Serbe, 1 Marokkaner. Als Todesursache
wurde zumeist „Kreislaufstörung“ oder „Herzschwäche“ eingetragen. Außerdem
wurden eingetragen: „tödliche Lungenentzündung“, Vergiftungen, 7 Erschießungen
und 2 Selbstmorde. Der marokkanische Staatsangehörige Mohamed Bachir wurde
nach Aussagen eines Wachmannes von ein oder zwei Schutzpolizisten erschlagen.
Im Liebenauer Standesamt ist unter seinem Namen die Todesursache „Kreislaufschwäche“
beurkundet. Im Bericht der Staatsanwaltschaft fehlen 3 Belgier, deren
Tod ebenfalls beurkundet worden war. Zur Praxis der Totenbegutachtung
durch den zuständigen Arzt äußerte sich dieser nach 1945: „Ich habe in
einer Vielzahl von Fällen natürlich den natürlichen Tod von Fremdarbeitern
in dem Lager Liebenau bescheinigt. In allen Fällen habe ich die Leichen
nicht zu Gesicht bekommen.“ Die Zeugenaussagen in den Unterlagen der polnischen
Hauptkommission zur Untersuchung der NS-Verbrechen weisen eine erhebliche
Zahl von „unnatürlichen“ Todesfällen aus: z.B. Erhängung von ein oder
zwei Polen wegen unerlaubter Beziehungen zu deutschen Frauen, die Hinrichtung
eines Arbeiterführers, das Erschlagen von mehreren Lagerhäftlingen mit
Knüppeln. Zeitweise wurde das AEL auch als „Gestapo-Hinrichtungsstätte“
genutzt, wobei die Hinrichtung von mindestens 9 Menschen nachgewiesen
ist. Vier dieser Hinrichtungen durch Erhängen sind in den Standesamtslisten
registriert.
Zitierte Quelle: Staatsarchiv Stade, Bestand Rep 171 a Verden acc 66/88
Literaturhinweise:
Rolf Wessels, Das Arbeitserziehungslager in Liebenau 1940 - 1943 (Historische
Schriftenreihe des Landkreises Nienburg/Weser, Band 6); Nienburg 1990
Gregor Espelage, Das Arbeitserziehungslager Liebenau. Ein Lager der Firma
Wolff & Co. mit Unterstützung der Gestapo Hannover; in: Die frühen Nachkriegsprozesse
- Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland
(hg. von KZ-Gedenkstätte Neuengamme), Bremen 1997
Andrea Tech, Arbeitserziehungslager in Nordwestdeutschland 1940-1945,
Diss. phil., Hannover 1998.
![]()